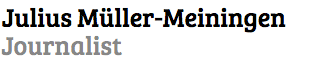Um zu verstehen, wie Mario Draghi tickt, muss man kein Volkswirt sein, geschweige denn Bankbilanzen lesen können. Es reicht eine Rückblende ins Jahr 2005, jenes Jahr, in dem Draghi als Gouverneur an die Spitze der Banca d’Italia rückte. Im Palazzo Koch, dem Sitz der italienischen Notenbank in der Via Nazionale in Rom, stand die Zeit, wie in den unzähligen anderen Adelspalästen der Stadt, in denen sich seit Jahrhunderten nichts verändert. Mit Draghi zog die Moderne ein. Der Pomp und die Historie des Hauses interessierten den gebürtigen Römer nie. Sein Vorgänger hatte einen Kofferträger beschäftigt, Draghi entband ihn von seinen Aufgaben und trug seine Aktentasche selbst. Für sein Büro wählte er ein schlichtes, modernes Design, ein Gemälde mit den Leiden des heiligen Andreas musste weichen. Gemessen an der Schwerfälligkeit des italienischen Bankenadels sind solche Maßnahmen nichts anderes als Exorzismus. Aber Draghi hatte da erst begonnen. Die größten Veränderungen musste der träge Organismus der Notenbank verdauen. Leitende Mitarbeiter bekamen Blackberrys, alle Computer erhielten einen Internetzugang. Noch heute halten die Mitarbeiter der Bank diesen, schon damals lange überfälligen
Schritt für eine Revolution. Als Draghi für sich selbst einen Laptop forderte, stellte sich die Technikabteilung quer. Ein tragbarer Computer, wozu das denn? Der Gouverneur verlor nicht etwa die Fassung. Er rief seinen Sohn Giacomo an und trug ihm auf, einen Laptop für Papà zu besorgen. Typisch Mario Draghi: Er sucht selten die direkte Konfrontation, sondern umgeht Hindernisse oder Kontrahenten, die sich ihm in den Weg stellen, lieber. Die anderen lässt er so einfach stehen. „Er ist ein Meister darin, Mehrheiten zu organisieren und gleichzeitig seine Gegner zu isolieren“, sagt ein Notenbanker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Vor zwei Jahren hat der 66 Jahre alte Draghi die Nachfolge des Franzosen Jean-Claude Trichet als Präsident der Europäischen Zentralbank angetreten. In der Krise um den Euro ist Draghi zum mächtigsten Mann Europas aufgestiegen, das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ihn kürzlich auf Platz 9 der einflussreichsten Menschen…