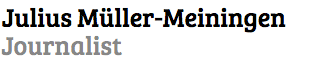Raffaele Cantone lebt mehrere hundert Kilometer weit entfernt von den Mafiabossen, die ihm nach dem Leben trachten. Aber seine drei Leibwächter lassen den ehemaligen Staatsanwalt auch im gut gesicherten Justizpalast in Rom nicht einen Moment aus den Augen. Die Mafia vergisst nicht. Nach Ablauf seiner regulären Amtszeit als Antimafia-Staatsanwalt in Neapel arbeitet er schon seit 2007 in Rom in einer Sonderabteilung des Verfassungsgerichts. Bekannt wurde der 47 Jahre alte Jurist durch seine Ermittlungen gegen den mächtigen Camorra-Clan der Casalesi. Einige Erinnerungen hat Cantone nun in einem Buch ("I Gattopardi", Mondadori-Verlag) zusammengefasst. Die Beziehungen zwischen Mafia und Fußball spielen darin eine zentrale Rolle. "Die Mafia interessiert sich vor allem deshalb für den Fußball, weil hier sehr viel Geld zirkuliert", sagt Cantone und wird im Fünf-Minuten-Takt von Kollegen in der Bar des Justizpalasts gegrüßt. Seine Ermittlungen, auf denen auch der Bestseller "Gomorrha" von Roberto Saviano fußt, haben ihn auch unter den Kollegen prominent gemacht. Die Mafia kontrolliere nicht nur Teile des Wettgeschäfts in Süditalien. "Fußballvereine wirken für viele Mafiosi wie Türöffner in
eine Welt, zu der sie sonst nur schwer Zugang bekommen." Der bekannteste Fall, den Cantone im Jahr 2004 aufdeckte, ist der Versuch der Camorra, den Erstligaklub Lazio Rom zu übernehmen. Bei seinen Ermittlungen gegen das illegale Müllbusiness der Casalesi stieß Cantone eher zufällig auf den Versuch eines Camorra-Unternehmers, mit Hilfe des Strohmannes Giorgio Chinaglia, einem früheren Fußballprofi, die Mehrheit an Lazio zu erwerben. Das notwendige Geld sollte über ein Konto in Ungarn laufen. Cantone vermutet, der Unternehmer Giuseppe Diana aus Casal di Principe habe so illegal erworbenes Kapital waschen wollen. Die Übernahme wurde durch die Ermittlungen gestoppt, Diana sitzt heute in Haft. "Besonders ein Aspekt wird an dieser Geschichte deutlich", sagt Cantone: "Die Camorra hat mittels eines Fußballvereins versucht, in einen anderen Kosmos vorzudringen." Man müsse sich nur einmal ansehen, wer in Rom auf der Ehrentribüne sitzt: Einflussreiche Unternehmer, hohe Amtsträger, Minister, Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen und über die…